Am Vorabend der patriotischen Heimatausmärsche
wird über eine Studie berichtet, nach der der „Rassismus in Österreich stark gestiegen“ ist.
Welcher Tag eignete sich daher vortrefflicher für das Erinnern an seinen Essay „Fragen der Zeit – Politik in Österreich“, den Robert Musil vor einhundertzehn Jahren schrieb, als ebendieser 26. Oktober 2023 …

Bloß der Nationalfeiertag eignet sich dafür, aus seinem Essay „Die Nation als Ideal und als Wirklichkeit“ zu zitieren, aus 1921, den Robert Musil also vor einhundertundzwei Jahren, in diesem schreibt
Robert Musil, dessen Geburtstag am 6. November zu feiern ist, über die „Zeugung von „Tischrassen“, die, in Fortführung seiner Beurteilung des „Rassegedankens“, ebenfalls nichts anderes als Rassismus gebärten.
Und kaum, daß es zum Nationalfeiertag graut,
schreibt schon der gar gegenwärtige Bundespräsident dieses Österreichs eifrig:
Ein großer Tag, ein wichtiger Tag für unser Land und alle, die hier leben. Ich wünsche Ihnen einen schönen, einen friedlichen #Nationalfeiertag!
Wir feiern heute unsere Heimat. Wir feiern Österreich.
Es fällt zu „Tischrassen“ unweigerlich die Bundesverfassung dieses Österreichs ein, in der „Tischrassen“ fehlt, aber nicht „Rasse“, auch weiter an diesem 26. Oktober 2023 —
Und wem dabei die Bundesverfassung des Landes einfällt, kommt nicht umhin, vor allem den Mann zu würdigen, der wie keine zweite Person in diesem Land in diese Verfassung vernarrt ist, die ihm, steht sie vor ihm, so schön und so elegant dünkt,
aber von ihm ein wenig gekränkt wird sie wohl sein, jedoch, vornehm wie sie ist, wird sie darüber schweigen, daß er sie stets um ein Jahrzehnt älter macht, als sie ist …

Nun genug, wesentlich ist, was Robert Musil vor einhundertzehn Jahren über die „Tischrassen“ zu schreiben sich genötigt sah, wohl,
ihm unwohl dabei, in Anbetracht eines noch mehr und mehr um sich greifenden, eines grassierenden, eines gestiegenen und bis in die tiefsten Tiefen weiter und weiter steigenden —
Es ist mir ferne, mich über die Rassenfrage verbreiten zu wollen, aber um zu ihrer ethischen Bedeutung zu gelangen, ist es allerdings nötig, an die theoretische Eigenart des Rassegedankens anzuknüpfen.
Wenn sich von einem bestimmten Augenblick ab die Tische durch Zeugung statt durch Bestellung vermehren würden, so würden wir alsbald aus den jetzt lebenden Tischen (und zwar mit der gleichen Evidenz, mit der wir in einem Friesen den Friesen erkennen) die Rassen der vierbeinig-rechteckigen, der einbeinig-ovalen und dergleichen mehr Tischrassen entstehen sehn. Es wäre gar nichts geschehn, als daß je zwei Tische einen dritten zeugten, der ihnen nach einem bestimmten Mischungsgesetz der Eigenheiten ähnelte und die Eigenschaft besäße, sich in der gleichen Weise weiter fortzupflanzen. Daß dabei ein Teil der Eigenschaften während mehrerer Generationen bloß in den Keimanlagen weitergereicht werden kann, ohne sonst in Erscheinung zu treten, ändert gar nichts daran, daß sich alles nur zwischen und an Individuen abspielt. Bei der ganzen Angelegenheit hat die Rasse nichts zu tun, als daß sie schließlich da ist, weil sie gar nirgends anders sein kann; so wie der Regen da ist, wenn Tropfen vom Himmel fallen. Sie selbst hat keine andere Möglichkeit, in das reale Sein einzutreten, als durch die Individuen, und keine andere[n] Wirkungen als die Wirkungen von Individuen; eine solche Existenz ist aber eben eine nur gedachte, ein Kollektivbegriff. Natürlich gibt es Rassen, aber die Individuen bilden die Rasse.
Ist das der Sachverhalt, so ist seine Umkehrung durchaus nicht berechtigt, und diese fast theologische Verdrehung lautet: das Individuum wird von Rassen gebildet. Bekanntlich ist gerade diese Formel die des Alltagsgebrauchs.
Es bleibt nach ihr von einem Menschen so wenig übrig wie von einem Strumpf nach Abzug der sich verkreuzenden Maschen. Meist mag es ja nur eine Bequemlichkeit der Verständigung sein, wonach ein Mensch zuerst durch seine Zugehörigkeit zu einer Gruppe gekennzeichnet wird – kann es die Familie X sein, warum also nicht auch die germanische Rasse? –, und es klingt uns heute schon fast natürlich, wenn Bismarck sagt, »das Fällen von Bäumen ist kein germanischer, sondern ein slawischer Zug«, oder ein jüdischer Kritiker von Wassermanns Buch Mein Weg als Deutscher und Jude behauptet, »es ist für einen Juden unmöglich, ein rein deutscher Künstler zu werden«: trotzdem ist es gerade in den harmlosen Fällen ein gefährliches Zugeständnis an eine lasterhafte Denkgewohnheit. Man kennt ja jene Literatur, die sie verursacht hat und von ihr verursacht wurde. Sie hat nicht Schädelindizes, Augenfarbe und Skelettproportionen, was nur wenig Menschen anlockt, zum Gegenstand, sondern Eigenschaften wie religiösen Sinn, Rechtlichkeit, staatsbildende Kraft, Wissenschaftlichkeit, Intuition, Kunstbegabung oder Toleranz des Denkens, von denen wir insgesamt kaum anzugeben wissen, worin sie bestehn, und spricht sie mit Hilfe eines anthropologischen Küchenlateins den angeblichen Rassen zu oder ab, weil sie glaubt, der Nation Würde durchs Ohr flößen zu können, wenn sie mit der Stimme der Jahrtausende vor ihr bauchredet.
Hier muß das Zitieren aus dem Essay von Robert Musil kurz unterbrochen werden, spricht er doch von dem „anthropologischen Küchenlatein“, das über einhundert Jahre später in Österreich immer noch gesprochen wird, am Stammtisch wie im Bundesministerium für „Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz“ —
Man wird nicht leugnen können, daß ein gut Teil unseres nationalen Idealismus in dieser Denkkrankheit besteht.
Wohin das führen muß, ist nicht schwer zu sehen. Wenn im Guten und Bösen für alles nicht der einzelne verantwortlich gemacht wird, sondern die Rasse, wirkt das genau so, wie wenn man sich immer auf einen anderen ausredet; die Folge ist nicht nur, daß Wahrhaftigkeit und intellektuelle Feinheit abstumpfen, sondern eine Entartung aller Keimzellen der Moral. Wo die Tugend durch Prädestination zum Nationaleigentum erklärt wird, ist der Weinberg des Herrn expropriiert, und niemand braucht fortab in ihm zu arbeiten. Es wird dem einzelnen vorgeschmeichelt, er besitze alles Wünschenswerte, so er sich nur auf die Tugenden seiner Rasse besinne: offenbar ein moralisches Schlaraffenland, unser glückliches Deutschland, wo die gebratenen Tugenden ins Maul fliegen!
Schwieriger scheint sich erkennen zu lassen, woher es kommt. Man sagt Antisemitismus, aber das ist fast nur ein anderes Wort für die Erscheinung selbst; das Wesentliche ist, daß sich hinter ihr ein echter Idealismus birgt, ein typischer Fall jenes regressiven Ideenbedürfnisses, das jeden Gedanken auf ältere, ewige, für erhaben geltende zurückbezieht statt ihn auszudenken; kurz eben das, was hierzulande für Idealismus gilt. Das erzeugt den Menschen mit dem festen Rezept und den erhaben einfachen Regeln, der sich des geistigen Erlebens überhebt, den Pharisäer. Es ist bei uns ein sonderbares und äußerst gefährliches Verhältnis entstanden: die Respektlosigkeit vor dem Geist im Namen des deutschen Geistes. Weite – und fast möchte man sagen die bestwilligen – Kreise unseres Volks haben es verlernt, eine Leistung nach ihrem Gehalt zu empfinden, und prüfen sie nur nach ihrer Herkunft und darauf, wie sie ins System der Vorurteile paßt; es wird das Weite am Engen gemessen, der mannigfaltige Geist an einer seiner Ausgeburten; die Aufmerksamkeit hat sich von den Werten zu ihren Nebenumständen abgewendet, von der Wirklichkeit zur Hypothese, und es hat sich derer, die zu folgen berufen sind, eine sektiererisch anmaßende Besserwisserei bemächtigt. Da mit etwas so Urtümlichem, wie es die Rasse ist, überdies nur urtümliche Tugenden verknüpft sein können, werden schließlich auch die Geister, welche sich des gleichen Bluts berühmen dürfen wie ihre Richter, nicht mehr ans Ohr der Nation gelassen, falls sie nicht so schreiben wie Herr Walter Bloem oder so denken wie Herr Hilthy [= Carl Hilty?], also nicht treu, tapfer, keusch sind und mit weiteren fünf deutschen Indianertugenden ihr Auslangen finden.
Auf diesem Wege des Idealismus ist der Rassengedanke zur deutschen Selbstbeschädigung geworden und saugt der Nation in jahrzehntelangem Mißbrauch das Mark aus.
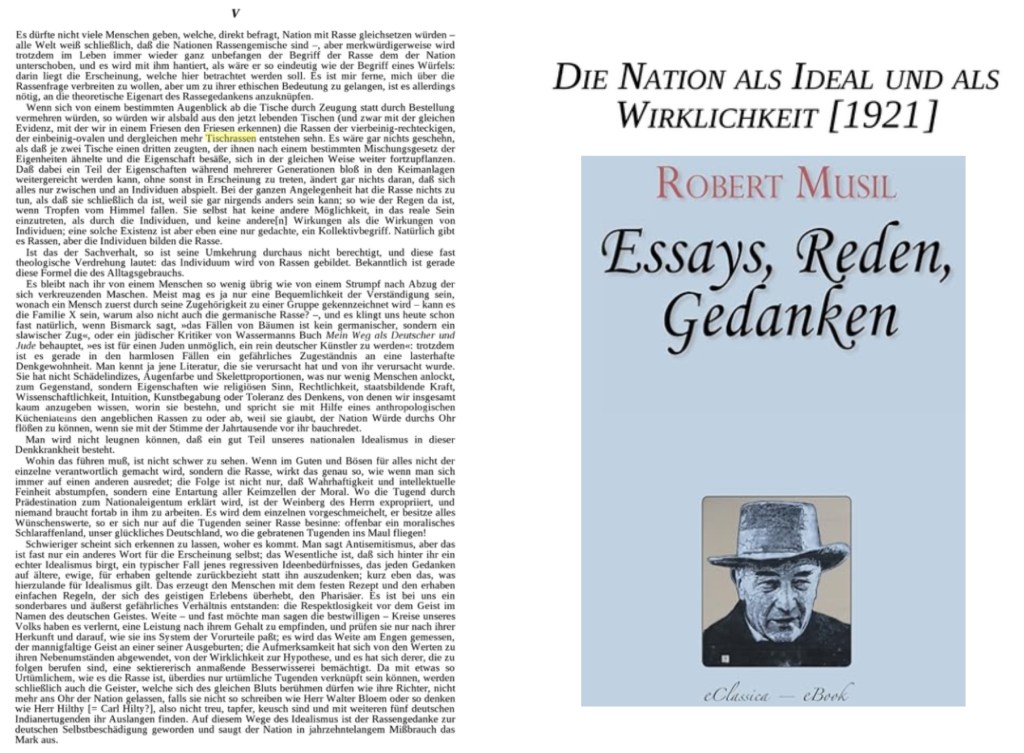

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.