Es lebte in Österreich ein Mann, auf den auch Kwame Anthony Appiah zu sprechen kommt, im Kapitel „Hautfarbe“, sein Name Angelo Soliman, und auf ihn in diesem Buch hätte Ronald Pohl beispielsweise auch in seiner Buchbesprechung hinweisen können, um das Buch für die Lesenden seiner Besprechung greifbarer zu machen, da es auch etwas mit Österreich zu tun hat, es also ein Buch ist, das es wert ist, erworben und vor allem gelesen zu werden, auch in Österreich, gerade in Österreich, in diesem Land, in dem beispielsweise ein Mann im Jahr 18 der für recht kurz gewesenen Bundesregierung „Paragraphe“ schreibt, ein Notar, der sich sonst vor allem als Hautfarbenfanatiker, als Hautfarbenfundamentalist hervorschreibt, ein „Spezial-Jurist“ für die recht kurz gewesene Regierung in Österreich, und dieser Notar mit seiner Regierung und mit seiner Waffenvernarrtheit, von dem nicht bekannt ist, daß er alle Waffen, deren Farbe nicht weiß ist, ablehnt, von dem nicht berichtet wird, daß er sich weigert, unweiße Waffen zu verwenden, fällt beim Lesen von „Die Lügen, die Fesseln“ ein, nein, das ist falsch, dieser fällt nicht beim Lesen von „Die Lügen, die Fesseln“ ein, sondern beim Lesen der Buchbesprechung von Ronald Pohl, weil es ein weiteres Mal auffällt, wie sehr es Ronald Pohl verabsäumt, diesen Bezug zu Österreich, auch zu Österreich, der mit diesem Buch geleistet wird, herzustellen, um den Verkauf dieses Buches in Österreich, gerade in Österreich, zu fördern, und er hätte dafür beispielsweise aus dem Buch zitieren können, diese Stelle über Angelo Soliman und Österreich, wobei auch zu erfahren ist, daß über Menschen ganz anders geschrieben werden kann, als es beispielsweise von dem Hautfarbenjuristen bekannt ist, über 200 Jahre vor dem Hautfarbenjuristen bereits ganz anders geschrieben wurde, und dies das zurzeitige Österreich nicht auszeichnet als ein Land, das sich in das Licht der Entwicklung stellen darf, und das darf zur Vermutung führen, Ronald Pohl möchte sein Land nicht so hingestellt wissen, wenn sein Land mit seiner Gegenwart so gesehen wird, wie es zu sehen ist, zu diesem Sehen gebracht durch die Lektüre dieses Buches „Die Lügen, die Fesseln“, weil dieses Buch eben dazu einlädt, das in ihm Geschriebene mit den Gegebenheiten, den Bedingungen, den Zuständen in dem Land abzugleichen, zu hinterfragen, ob das in ihm Geschriebene auch und wie auf dieses Land zutrifft, in der sich Lesende dieses Buches gerade beim Lesen dieses Buches aufhalten …
Der Geistliche Abbé Grégoire, der große französische Revolutionär und Kämpfer gegen die Sklaverei, veröffentlichte 1808 eine Untersuchung über die kulturellen Leistungen von Schwarzen. Er gab ihr den Untertitel „Untersuchungen über ihre geistigen Fähigkeiten, ihre moralischen Qualitäten und ihre Literatur“. Und er führte Amo als Beweis für seinen Glauben an die Einheit der Menschheit und die fundamentale Gleichheit der Schwarzen an. Thomas Jefferson hatte in seinen Notes on the State of Virginia (1785) geschrieben, er habe nie erlebt, „dass ein Schwarzer einen Gedanken geäußert hätte, der über das Niveau der einfachen Erzählung hinausgegangen wäre“. Grégoire schickte ihm ein Exemplar seines Buchs De la littérature des Négres, in dem sich eine ausführliche Darstellung des Lebens und Werks Anton Wilhelm Amos befindet, und bat ihn, seine Ansichten zu überdenken.
Amo war nicht das einzige Gegenbeispiel zu Jeffersons negativem Bild des „Negers“. Grégoire nennt als beispielhaften „Neger“ auch Angelo Soliman – gleichfalls ein als Kind versklavter Westafrikaner, der einer Marquise in Messina zum Geschenk gemacht wurde, die für seine Erziehung sorgte; später wurde er Hauslehrer des Sohnes Fürst Wenzels von Liechtenstein in Wien und Mitglied derselben Freimaurerloge, der ein paar Jahre nach Amos Rückkehr nach Ghana auch Mozart angehörte. Soliman war berühmt für die Spaziergänge, die er Arm in Arm mit dem Kaiser durch Wien unternahm. Der revolutionäre französische Geistliche erzählt außerdem die bereits ältere Geschichte von Juan Latino, dem Dichter und Professor für Grammatik und Latein im Granada des 16. Jahrhunderts. Als „El negro Juan Latino“ erscheint er im ersten der possenhaften Gedichte, mit denen Cervantes seinen Don Quijote beginnt. Der schwarze Professor wird deshalb erwähnt, weil er das Lateinische beherrschte – im Gegensatz zu Cervantes, der deshalb in der spanischen Volkssprache schreiben musste.
Als Jefferson De la littérature des Négres las, dürfte er sich auch an seine Landsfrau Phillis Wheatley erinnert haben, die 1773 das erste Buch mit Gedichten einer Afroamerikanerin veröffentlichte.“
Das „erste Buch mit Gedichten einer Afroamerikanerin“ läßt sogleich an ein Buch erinnern, das mit Österreich zusammenhängt, mit der erstmaligen Veröffentlichung von „afro-amerikanischer Lyrik in Wien, 1929 …
Ronald Pohl beginnt seine Buchbesprechung mit einer Frage, die er sich bei Appiah abgeschaut hat: „Wer sind wir? Oder sollte die Frage besser lauten: Was sind wir?“
Wenn an Amo, an Soliman, an Latino, an den Urgroßvater von Alexander Puschkin, an die vielen, vielen weiteren gedacht wird, auch daran, was noch 1929 in Wien veröffentlicht wurde, was zur Zeit von Menschen über Menschen verbreitet wird, ist in Anknüpfung an Tucholskys „Gehn wir weiter“ die Frage angebrachter:
Warum gehen wir nicht weiter? Und wohin gehen wir, wenn wir nicht weitergehen?

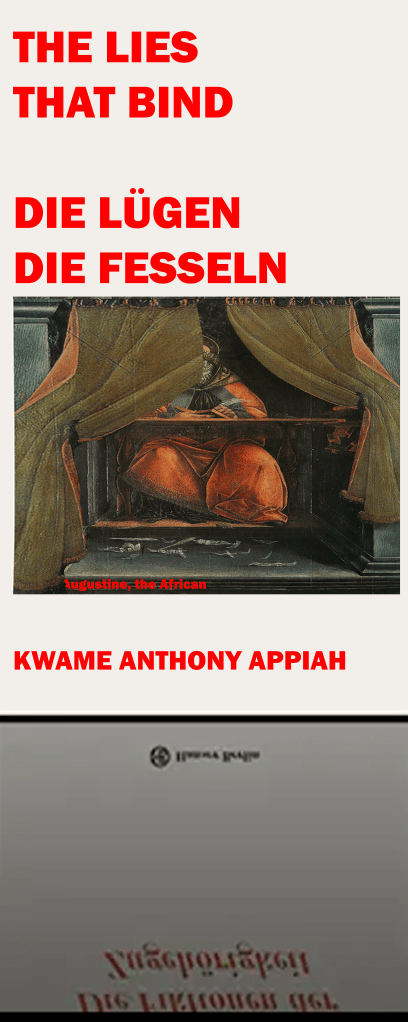

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.